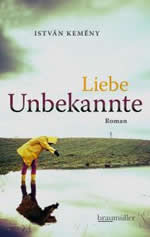 Roman
Roman
Aus dem Ungarischen von Timea Tankó
Verlag Braumüller, Wien, 2013; 876 Seiten
ISBN: 978-3-99200-098-2
Originaltitel: Kedves Ismeretlen, 2009
Bezug: Buchhandel; Preis: 28,90 Euro
Schade, dass dieses ungewöhnliche Buch bisher noch nicht bei den Kritikern der großen Zeitungen in Deutschland gelandet ist: Ungarische Geschichte der 70er und 80er Jahre „einmal anders“. Eine große Familiengeschichte wird hier aufgeblättert in vielen kleinen Erzählungen, Skizzen und Geschichtchen, welche uns mitten hinein nehmen die die Atmosphäre dieser Jahre. Es ist keine Autobiografie, doch alles ist so gut erfunden, dass es einfach wahr sein muss. Mit dem Ich-Erzähler des Romans, Tamás Krizsán, hat der Autor nicht nur das Geburtsjahr gemeinsam. Er erzählt im Rückblick des Erwachsenen mit sarkastischem Humor und subtiler Ironie, wie das Kind und der Jugendliche die Ära der Kádár-Zeit, bei uns oberflächlich und beschönigend „Gulaschkommunismus“ genannt, erlebt hat: Nämlich den Stillstand des „reifen Sozialismus“, in dem sich in den nächsten 50 Jahren mit Sicherheit nichts ändern würde.
2008, mit 46 Jahren arbeitet der Erzähler an seiner Zeitmaschine, an seinen Erinnerungen. Ihm fallen Szenen ein aus der Zeit, als er Praktikant in der Korvin Bibliothek war, er erinnert sich an seine Kindheit und Jugend. Jede Assoziation mündet in einer facettenreichen Geschichte oder Miniatur.
Es sind aber nicht nur seine eigenen Erinnerungen, sondern die einer ganzen Generation von jungen Leuten, die herumhängen, weil Leere und Langeweile von ihnen Besitz ergriffen haben und weil der kommunistische Staat ihnen keine Zukunftsperspektiven bieten kann. Von ihren Eltern wissen sie wenig, eher Ungenaues. Vorsichtig reden alle um den heißen Brei herum, um auf den Punkt zu kommen – wenn überhaupt. Die Jungen müssen sich selbst etwas zusammenreimen; denn die Alten schweigen sich über ihr Schicksal aus. Die Bevölkerung hat ihr Leben in einer Mischung aus Angst und Fatalismus eingerichtet, sie begegnet den Widrigkeiten und Zumutungen mit Ironie und Sarkasmus.
István Keménys Protagonist spaltet sich immer wieder auf: er lässt Tamás von seinen eigenen Beobachtungen und Erlebnissen erzählen, gleichzeitig erklärt ein Erzähler im Hintergrund die Zusammenhänge, verschmilzt dann aber wieder mit dem Ich-Erzähler. Beide haben herrlich ironische, humorvolle, melancholische und sarkastische, längere und kürzere Geschichten zu erzählen über die Eltern, Schwestern, Onkel und Tante, über die Freunde der Familie und deren Kinder, über die späteren Kollegen und Freunde. – und dies in allen Einzelheiten. Tamás, der junge zurückhaltende Mann mit Brille, der so gar kein Draufgänger ist – obwohl seine Familie ihn gern als solchen sähe, beobachtet jeden um sich herum sehr genau; er kann offenbar gut zuhören und durchschaut die Menschen, ist aber auch gutmütig und lässt sich leicht beeinflussen. Er schreibt Gedichte und versucht als junger Mann den „übermenschlichen Menschen“ aus sich herauszuarbeiten.
Seine Familie, eigentlich eine Gruppe von Pechvögeln, versucht vor allem eines: Unauffällig zu leben. Der Vater wurde 1956 verhaftet und kam ins Gefängnis. Nach seiner Entlassung arbeitet er wegen „politischer Unzuverlässigkeit“ als Nachtportier einer Konservenfabrik, die Mutter verpatzte ihre Diplomprüfung und wurde dann Logopädin, die älteste Schwester Gerda wollte Medizin studieren, bekam aber nie die Zulassung. Ihre Ambitionen im Filmgeschäft berühmt zu werden, erfüllten sich auch nicht – schließlich zieht sie wieder ganz nach Hause. Die jüngere Schwester Erika, hübsch und beliebt, heiratete früh, kehrt aber dann mit ihrem kleinen Sohn allein ins Elternhaus zurück. Die Hoffnungen der Familie ruhen natürlich auf Tamás, aber auch er enttäuscht, wie er selbst weiß. Bis er in der Korvin Bibliothek ein Praktikum macht, hat er im Leben noch nichts geleistet. Jeder wurstelt sich durch und obwohl es immer wieder heftige Meinungsverschiedenheiten – auch mit der Familie von Vaters Bruder gibt, halten sie zusammen und haben ein Auge aufeinander. Die Familie, der einzige sichere Ort in diesen unsicheren Jahren. Nur eines ist gewiss: Man darf nicht auffallen, muss sich arrangieren. In diesem Rahmen hält die Familie fest an Brauchtum und Tradition, wie z. B. dem Begießen mit Parfüm an Ostern, dem Kauf eines adäquaten Tannenbaums, den gemeinsamen Festen und den immer gleichen „politischen“ Gesprächen. Angst herrscht überall, eine diffuse Angst: Angst vor dem Staat, vor unbekannten Krankheiten, vor dem 3. Weltkrieg, über dessen Nähe auf Versammlungen und in der Schule immer wieder gesprochen wird. Die Katastrophe von Tschernobyl ereignet sich in diesen Jahren. Die Menschen sind verunsichert aber leichtsinnig, die Jugend sarkastisch bis zynisch. Ständig kocht die Gerüchteküche, auch wenn die Gerüchte noch so irreal sind: Die Donau würde umgelenkt und aufgestaut, eine Schattenregierung würde gebildet. Wenn solche Gerüchte auftauchen, wagt man es nicht, Angefangenes zu vollenden; das Leben stagniert und stockt irgendwie an dieser Stelle. Alles scheint möglich – der Regierung, dem Staat wird alles zugetraut. Angst herrscht, abgehört zu werden und Angst macht sich breit, nicht nur, etwas von sich preiszugeben, sondern auch, etwas über andere zu erzählen, was diesen schaden könnte. Schon lachhaft mutet die Unbeholfenheit an, darum herum zu steuern. Mit vielen solcher kleinen Momenten beleuchtet Kemény anschaulich die Stimmung im Land.
Miniaturerzählungen sind auch der Donau gewidmet, dem Fluss, der eine Art Organismus ist und eine Seele hat, ein ständiger Gedankenstrom, der durch das gesamte ehemalige Habsburger Reich fließt und Menschen und Völker nicht nur eint, sondern auch trennt: „…. das Wasser des klein[st]en Bachs… fließt irgendwann in die Donau. In den Strom, der aus der zivilisierten Welt hinaus fließt, von Westen nach Osten…. In das unbewegliche Schwarze Meer des Ostens, der Rückständigkeit. Das weckte in den im Donaubecken lebenden Menschen von Bayern bis in die Bukowina eine … gemeine und beißende Begierde, die heute noch besteht und wächst. Es ist eine kleinliche, perfide, zur Zerstörung anstichelnde Begierde, genährt vom Gefühl, aus allem Großen, Wichtigen und Schönen der Welt ausgeschlossen zu werden. Sie glauben, immer und immer wieder aus allem ausgeschlossen zu werden und dass sich daran auch niemals etwas ändern werde“… Aber die Donau ist auch besorgt um ihre Anwohner. Wenn es nötig ist, kommt sie brausend daher, reißt alles mit, um denen, die das spüren, beizustehen und sie zu trösten.
Umsonst wird man die „Korvin-Bibliothek“ unter den Sehenswürdigkeiten Budapests suchen. Trotzdem ist sie der Mittelpunkt aller Personen, die hier auftreten, irgendwie hängen alle und alles mit ihr zusammen. Sie ist die letzte Bastion ungarischer Kultur, der das „Institut für Herausgabe von Enzyklopädien“ angeschlossen ist. In ihr leben und arbeiten so manche skurrile Gestalten: Die großen und kleinen Wissenschaftler, die Biografen, die Angestellten, diejenigen, die sich irgendwo in den weitläufigen Räumen häuslich niedergelassen haben – und die Künstler, die verwahrlost und genügsam in der Unterwelt, in den Kellerräumen hausen. Die Wissenschaftler lassen sich selten oder nie blicken, die übrigen Angestellten täuschen Tätigkeit vor, Besucher gibt es kaum, die Mannschaft kreist um sich selbst. Ein täglicher „Leser“ ist allerdings ein Graf, der die 10 Bände der „Genealogischen Beschreibung der Familien des Ungarischen Hochadels“ um sich aufbaut, um dahinter zu schlafen.
Der Bibliotheksdirektor war Endre Olbach, ein Wissenschaftler, Chefredakteur der Ungarischen Großenenzyklopädie, der bekannt, vergessen, wiederentdeckt und schließlich ganz vergessen wurde. Noch ist er eine anerkannte Persönlichkeit, doch sein Gegenspieler, der parteitreue, zynische Dozent Patai nimmt bereits seinen Platz ein. Dieser Patai, Mephistino genannt, ist eine zwiespältige Figur: Einerseits hat er sowohl Tamás’ Familie als auch der Familie Olbach übel mitgespielt. Er ist zynisch, beobachtet die Menschen und versucht sie für seine Zwecke einzuspannen. Andererseits ist er ein „Meister“-Typ, der durch Auftreten und Eloquenz die jungen Menschen, die noch ihren Weg suchen, an sich bindet. In seinen philosophisch-marxistischen Vorlesungen (in den 80er Jahren) ist er geradezu prophetisch: ….Niemand ist für irgendetwas verantwortlich…. Die Seele fürchtet sich zutiefst vor dem Verstand und der Verstand schaudert, wenn er an die Seele denkt. …Letztendlich wird auf jeden Fall eine das Gehirn mit angenehmen Träumen manipulierende, technisierte Gesellschaft entstehen. Und danach kommt das Nichts… Das gewisse Große Nichts. … Es handelt sich hierbei nicht um ein Problem der fernen Zukunft. Wenn wir von den heutigen Tendenzen der westlichen Technik und Wissenschaft ausgehen, werden wir innerhalb von hundert Jahren im Großen Nichts angekommen sein…“. Patai „sammelt“ geradezu, seit er Witwer ist, junge Leute um sich, „fängt“ sie ein, lässt sie in der Bibliothek wohnen. Man weiß, dass er sich einen Spaß daraus macht, seine Anhänger irgendwann zu demütigen, doch sogar dieses nehmen sie fasziniert in Kauf.
Einer seiner Bewunderer ist Gábor, ein junger Angestellter, mit dem Tamás Freundschaft schließt – und hofft, dass es eine große Freundschaft wird. Gábor wiederum ist mit Kornél befreundet, von dem er erwartet, dass dieser ihm den Sinn des Lebens erschließt: „Wieso ist es so, dass wir hier in Budapest sitzen und in uns das große Nichts herrscht…?“ Alle drei Freunde vertrödeln ihre Zeit, sitzen sie ab im Bewusstsein, dass sich nie etwas ändern wird.
Mit den Olbachs ist Tamás schon seit seiner Kindheit bekannt. Mit ihrer Enkelin Emma haben seine Schwestern ihn schon immer geneckt, sie sei seine Verlobte. Emmas Vater hat sich ins Ausland abgesetzt. Er kommt erst wieder zur Beerdigung seiner Mutter, Mara Olbach, nach Ungarn. Bis dahin hatte auch Tamás seine „Verlobte“ gänzlich aus den Augen verloren. Jetzt, in der Gegenwart, so erfahren wir, sorgt er für sie als seine Ehefrau, indem er die Melancholie, das Künstlertum und alles Ungemach auf seine Schultern nimmt, damit sie eine fröhliche starke Frau und Mutter sein kann.
Emma wäre nämlich gern Schriftstellerin geworden, hätte gern einen unschreibbaren Roman verfasst. Der Roman wurde aber von einem anderen geschrieben: „…. als der Roman mit dem Titel „Wunderbare Weitschweifigkeit“ erschien, wurde Emma endgültig bewusst, dass es unmöglich war, so einen Roman zu schreiben, denn in diesem war alles enthalten: Er spielte heute und früher, war lustig und (nicht sehr) düster, es gab darin Liebe (in Maßen) und Gnadenlosigkeit – nur ein Geheimnis kam darin nicht vor. Damit ist in wenigen Sätzen der Roman „Liebe Unbekannte“ beschrieben. Allerdings, hier gibt es schon ein, sogar mehrere Geheimnisse. Das größte Geheimnis ist vielleicht die „Zeitmaschine“, an der schon Tamás’ Vater baute, sie aber nicht vollendete. Auch Tamás arbeitet ab einem gewissen Alter daran. Die Zeitmaschine ist dieser Roman, der sowohl die Vergangenheit, als auch die Zukunft heranholt und verbindet. Nur die Gegenwart ist eigenartig luftleer – und kommt kaum vor. „… Die Geschichte ist meine Zeitmaschine. Ich habe mich sehr bemüht, sie zu beenden, nicht dass es mir so ergeht wie Vater, dem Armen, dessen Zeitmaschine unvollendet geblieben ist…“
„…Und ich kämpfe auch für den Sinn ihres [Emmas] Lebens, wobei die Vernunft mir sagt, dass es ein hoffnungsloser Kampf ist, denn dieses wird tatsächlich das letzte menschliche Jahrhundert sein. Ich glaube jedoch genauso an Ausnahmen und Wunder wie Emma. Also an die Zukunft. An eine Art letzten Sinn der Dinge….
Die fast 900 Seiten sollten den Leser nicht abschrecken, im Gegenteil, man könnte gern noch eine Weile weiterlesen, süchtig geworden von den vielen liebevoll gezeichneten Miniaturen, die uns Menschen und Land in einer bestimmten Zeit so nahe bringen.

